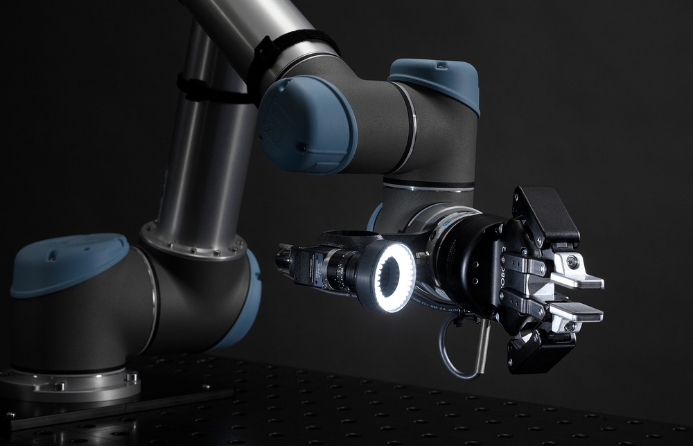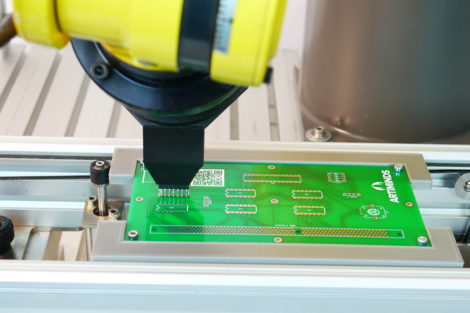Den Titel als Exportweltmeister des Maschinenbaus hat Deutschland an China verloren. Deutsche Maschinen werden austauschbarer, die Margen sinken. Kann die Digitalisierung helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben?
Rodig: Die Digitalisierung bietet Unternehmen drei wesentliche Ansatzpunkte, um ihre Performance zu steigern. Sie können ihre Prozesse automatisieren, um die Wertschöpfung schneller, günstiger und sicherer zu machen. Sie können über digitale Kanäle Kunden gewinnen. Und sie können durch innovative Services oder Geschäftsmodelle neue Erlösquellen erschließen.
Vor allem letzteres fasziniert gerade viele Maschinenbauer.
Rodig: In der Tat, denn die Margen solch ergänzender Software-Services – beispielsweise Online-Zustandsüberwachung oder sogar ein Product-as-a-Service-Geschäftsmodell – können höher sein als im Kerngeschäft, die Umsätze stabiler und die Kundenbindung stärker. Darüber hinaus lernt man aus den Daten viel über seine Kunden. Der wichtigste Effekt digitaler Mehrwertdienste wird allerdings oft übersehen: Sie stärken das Kernprodukt durch Differenzierung – so kann man mehr Maschinen verkaufen und dabei höhere Preise erzielen. Der schnelle zusätzliche Euro durch Software hingegen bleibt meist eine Illusion. Nur wenige Maschinenbauer schaffen beim Umsatzanteil digitaler Dienste bislang mehr als drei Prozent.
Wo liegt nun das Problem?
Rodig: Nach meiner Erfahrung hat das vor allem drei Gründe. Erstens: Kunden zahlen für klare Mehrwerte, die sich in kurzer Zeit verlässlich rechnen. Daran fehlt es oft – vor allem weil konsequent kundenzentrierte, datengetriebene und methodisch saubere Entwicklungsprozesse für Software noch immer selten sind. Agile Softwareentwicklung allein hilft da kaum. Zweitens: Bei dem zunehmenden Fachkräftemangel ist es schwer, die nötigen Kompetenzen an Bord zu bekommen, um überzeugende digitale Services anbieten zu können. Drittens: Wenn man dann tatsächlich ein funktionierendes Digital-Team zusammenstellen kann, wird es nur mit den richtigen Rahmenbedingungen wirksam. Dabei geht es um weit mehr als die Frage, ob hippe Digital Natives und bodenständige Ingenieure miteinander klarkommen.
Sondern? Worum geht es stattdessen?
Rodig: Es geht um einen ernstgemeinten organisatorischen und kulturellen Wandel. Denn Softwareprodukte, die die Kunden durch einen hohen Mehrwert und eine tolle Nutzererfahrung begeistern, entstehen nicht in hierarchischen Führungssystemen mit organisatorischen Silos und Wasserfall-Vorgehen. Davon mal ganz abgesehen: Der organisatorische und kulturelle Wandel ist ohnehin nötig, damit Unternehmen in der heutigen dynamischen VUCA-Welt bestehen können. Hübsche Power-Point-Folien, ein Kickertisch oder gut gemeinte Appelle reichen nicht. Es braucht tiefgreifende Veränderungen an Strukturen, Prozessen sowie Anreiz- und Beurteilungssystemen. Dieser Wandel ist langwierig und schmerzhaft, meist gibt es große Widerstände.
Warum ist der Widerstand so groß?
Rodig: Man wirft damit gewachsene Hierarchien, tradierte Entscheidungswege und eingespielte Machtverhältnisse über den Haufen. Das erzeugt natürlich Unsicherheit, Angst und Unruhe im Unternehmen. Schließlich geht es um einen Paradigmenwechsel – weg vom Hersteller, hin zum Dienstleister. Das verändert das ganze Denken: Überwog gestern noch der Stolz auf perfekte Maschinen, geht es morgen nur noch ganz nüchtern um den Mehrwert für den Kunden. Verkauft wird am Ende nur noch der Output. Damit verschiebt sich auch die interne Bedeutung verschiedener Fachbereiche: Gaben bisher Ingenieure den Ton an, gewinnen nun Programmierer, Data-Analytics-Experten und Spezialisten für User Experience an Bedeutung. Das gefällt nicht jedem und sorgt natürlich für Spannungen. So kommt es zu internen Kämpfen und Abstoßungsreaktionen.
Wie überwindet man diesen Widerstand?
Rodig: Wenn der CEO nur noch von der tollen digitalen Zukunft spricht, hängt er viele wertvolle Alteingesessene ab. Ein konstruktives Miteinander von Neu und Alt erfordert eine sorgfältige Balance der Wertschätzung. Und ein Verständnis dessen, was eine digitale Firmenkultur im Kern ausmacht. Zentral sind dafür drei Elemente. Das erste ist kundenzentriertes Denken: Maschinenbauer müssen sich stärker als früher fragen: Was sind die wesentlichen Bedürfnisse meiner Kunden? Wollen sie Kosten reduzieren, mehr Flexibilität oder ist etwas anderes wichtig? Das impliziert einen Wandel vom Produkthersteller, der sich über technische Innovationen, Perfektion und Präzision definiert, hin zum Problemlöser.
Was ist der zweite Aspekt?
Rodig: Datengetriebenes Entscheiden. Alle Entscheidungen sollten auf Basis aussagekräftiger Daten getroffen werden. Zu viele Maschinenbauer entwickeln neue Produkte noch immer auf Basis von Bauchgefühl oder persönlicher Vorlieben.
Müssen sich auch Arbeitsprozesse ändern?
Rodig: Unbedingt. Agiles Arbeiten ist das dritte Element. Unternehmen müssen stärker in Teams denken, die sich selbst organisieren, interdisziplinär sind und Verantwortung tragen. Neu daran ist vor allem eine iterative Vorgehensweise: Statt bis zur Perfektion zu tüfteln, heißt es heute Prototypen früh am Kunden zu testen und die Funktionalität Schritt für Schritt zu verbessern. Dafür muss ich mich zugleich stärker nach außen öffnen, hin zu den Kunden, aber auch für Partner, die neue Kompetenzen einbringen.
Das ist ganz schön viel verlangt vom traditionellen Maschinenbau.
Rodig: In der Tat, das ist ein großer Schritt. So etwas macht man ja auch nicht in einem Jahr, das ist ein langer Prozess. Man startet meist mit nur wenigen Unterstützern im Unternehmen. Wenn man die ersten „Veränderungsinseln“ klug auswählt und sich langsam Erfolge einstellen, baut sich sukzessive ein Momentum auf. Das sollte man nicht versuchen übers Knie zu brechen. Schließlich ist eine agile, datengetriebene und kundenzentrierte Arbeitsweise das Gegenteil dessen, was bei den meisten Mittelständlern bislang üblich ist. An die Stelle des Produkts tritt der Kunde. An die Stelle des Einmalverkaufs treten Abo-Modelle. An die Stelle von Hierarchie und langen Berichtswegen treten flache, partizipative Strukturen und dezentrale Entscheidungen. An die Stelle von Kontrolle tritt Vertrauen. Das stellt vieles auf den Kopf. Die Führung sollte das früh offen ansprechen, das „Warum“ immer wieder erklären und selbst konsequent den Wandel vorleben.
Struktur Management Partner GmbH
www.struktur-management-partner.com
Die drei Säulen des digitalen Wandels
Digitalstrategie: Auf Basis einer fundierten Analyse sollte das Unternehmen präzise Aussagen zu den drei Werthebeln erarbeiten: Prozessdigitalisierung, Marketing- und Vertriebsdigitalisierung sowie digitale Services und Geschäftsmodelle. Wo liegen die wesentlichen Potenziale und Handlungsbedarfe, wo setzen wir den Schwerpunkt? Wie sieht unser Zielbild aus, wie der Weg dorthin?
Organisation: Wie lässt sich die Digitalstrategie umsetzen? Welche digitalen Fähigkeiten sollten wir über Neueinstellungen oder Zukäufe intern aufbauen, welche lassen sich besser über externe Partner wie IT-Firmen, Plattformen oder Startups abdecken? Wo sollten Digitalkompetenzen organisatorisch aufgehängt werden? Welche Prozesse müssen neu gedacht werden?
Firmenkultur: Im Verlauf sollten die Arbeitsgepflogenheiten aktiv hinterfragt und, wo sinnvoll, angepasst werden: Wie erfolgt Führung? Wie, wo und von wem sollten Entscheidungen getroffen werden? Wie wollen wir künftig mit Fehlern umgehen? Welches Verhalten wollen wir fördern?
Digitaler Kulturwandel:Sieben Praxistipps
- Setzen Sie sich realistische Ziele für die Digitalisierung und seien Sie geduldig.
- Ermitteln Sie die digitalen Kompetenzen und Wissenslücken sowie die Werte, Motivationen und Schmerzpunkte Ihrer Führungsmannschaft.
- Gewinnen Sie Zweifler mit gezielten schnellen, ersten Erfolgen.
- Schaffen Sie motivierte, beharrliche Teams und klare Verantwortlichkeiten.
- Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren.
- Passen Sie auch Kennzahlen, Beurteilungsprozesse und Vergütungsprinzipien an.
- Leben Sie den Wandel als Führungskräfte selbst vor.
Mehr zum Thema Industrie 4.0